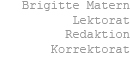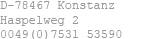Geschmeidig, nüchtern, hemmungslos:
Schweizer Unternehmen im Nationalsozialismus
In der südbadischen Kleinstadt Singen profitierten Schweizer Tochterfirmen zwischen 1933 und 1945 vom Krieg – unter anderem mit ZwangsarbeiterInnen aus dem Osten.
Die Führungsspitze der Georg Fischer AG in Singen war enttäuscht. Da hatte sie doch wirklich lange genug ihre «guten Dienste in den Fremden-Lagern» unter Beweis gestellt, und die Verwaltung der südbadischen Kleinstadt schien das nicht zu würdigen: Obwohl der Krieg seit drei Monaten vorüber war, machten sich «die Russen» noch immer auf ihrem Gelände breit.
Und kaum konnte man ihrer Herr werden. Das Schwein, das die ehemaligen ZwangsarbeiterInnen sich (und das bereits zum zweiten Mal!) aus irgendeinem Stall besorgt und geschlachtet hatten, war für die Direktoren der Georg Fischer AG sicher nicht das Schlimmste. Gegen Plünderungen im eigenen Werk hatten sie einen Stacheldraht zwischen Lager und Fabrikgelände ziehen müssen, außerdem suchten die Lagerinsassen gelegentlich ihre ehemaligen Bewacher auf. Auch die Anwohnerschaft musste sich nachts mit Trillerpfeifen und Warndrähten vor unerbetenen Gästen schützen. Sie alle hätten wohl freudig sämtliche Schweine der Stadt hingegeben, wären sie nur endlich die Zeugen der letzten Jahre losgewesen.
Die rund vierhundert ArbeiterInnen aber dachten nicht daran. Jahrelang seien sie in Singen gewesen, hatten sie der Firmenleitung bereits im Mai erklärt, da könnten sie auch noch ein paar Wochen länger auf die Heimfahrt warten. Und warum auch nicht? Endlich durften sie sich frei bewegen – und sie konnten leben ohne die Angst, geprügelt oder ins KZ abgeschoben zu werden. Seit Jahren stimmte zum ersten Mal auch der Speiseplan, dafür hatte die französische Militärbehörde gesorgt: Zum Frühstück gab es «Aufschnitt, Eier, Kaffee, Milch (Vollmilch), Brot (beliebige Menge) und Marmelade», mittags und abends: «Hors d'oeuvre (Vorgericht mit Eiern), Fleischgericht mit zwei Gemüsen, Käse und Butter, zwei Süßspeisen mit Kaffee und Likör.» Ein paar Monate zuvor hätten sie, wie die sieben Millionen anderen ZwangsarbeiterInnen in Deutschland, viel darum gegeben, das Lager, die Stadt, das Land einfach hinter sich lassen zu können. (1)
Singen, eine Schweizer Kolonie
Die südbadische Kleinstadt Singen am Hohentwiel ist im Grunde genommen eine Schweizer Gründung. Ohne die Dependancen der Würzmittelfirma von Julius Maggi (sie ließ sich 1887 in Singen nieder), der Fittingrohr-Fabrik Georg Fischer AG (1895) und des Aluminiumwerkes Dr. Lauber, Neher & Cie (1912) wäre die Stadt vermutlich heute noch ein Dorf. Der kleine Flecken hatte die Schweizer Fabrikherren damals gereizt: Kurz hinter der Grenze gelegen, bot Singen Zugang zum deutschen Markt, einen Eisenbahnanschluss an das deutsche Verkehrsnetz, ein geringes Lohnniveau und eine große Zahl ländlicher ArbeiterInnen ohne Gewerkschaftserfahrung.
Die Ortschaft wuchs mit den drei Betrieben. 1897, als Julius Maggi seinen Würzmittelvertrieb in die deutsche «Maggi-Gesellschaft mbH Singen» umwandelte, wohnten gerade 1800 Menschen hier, 1912 waren es bereits über 8000. Das Industriedorf entwickelte sich bald zur schwarzroten Hochburg, immer wieder kam es zu erbitterten Arbeitskämpfen.
Bei den Reichstagswahlen 1932 – Singen hatte nun 15.000 EinwohnerInnen – war die Kommunistische Partei mit knapp 24 Prozent der Stimmen nach dem katholischen Zentrum die zweitstärkste Partei. Mit der Machtübergabe an Hitler 1933 aber wurde, wie überall, alles ganz anders.
Mitte der zwanziger Jahre noch hatte Fritz Neuert, Sozialdirektor des Singener Maggi-Werks, bedauert, dass es jetzt nicht allzu schwer wäre, «den Gewerkschaften vollends den Garaus zu machen», er wisse aber, «was nach der Zerschlagung der Gewerkschaftsmacht von den Kommunisten geplant ist». Die neuen Machthaber verboten nun nicht nur die Kommunisten, sie erledigten auch gleich die Gewerkschaften mit.
1934 bereits waren alle Betriebsratsgremien der Singener Unternehmen gegen «Vertrauensleute» des nationalsozialistischen Gewerkschaftsersatzes Deutsche Arbeitsfront ausgetauscht. Lohntarife und Arbeitsbedingungen legten nun Beamte, die sogenannten Treuhänder der Arbeit, fest. Und diese bescherten bald den ersten Lohnstopp und die Ausweitung der Arbeitszeiten.
Neuert konnte getrost der NSDAP beitreten. Die anderen Werksdirektoren zeigten sich nicht weniger zufrieden. Aluminium-Chef Hans Constantin Paulssen dankte mehrmals für die gute Wirtschaftslage, und Ständerat Julius Bührer, Generaldirektor der Georg Fischer AG (GF) im Schaffhauser Stammwerk, lobte die Vorzüge, «welche der neue deutsche Staat seiner Wirtschaft» geboten habe, und frohlockte, dass Ausstände und Arbeitsniederlegungen nun endlich der Vergangenheit angehörten.
Wollten die Nationalsozialisten ihre Macht stabilisieren, mussten sie so schnell wie möglich die hohe Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Staat und Partei baten die Wirtschaft deshalb eindringlich um Neueinstellungen – besonders verdiente Parteigenossen sollten in Lohn und Brot gesetzt werden. Zwischen 1933 und 1935 verdoppelte sich die Belegschaft der Aluminium-Walzwerke von 600 auf 1200 Beschäftigte, die der GF stieg von rund 1000 auf fast 1400; Maggi erhöhte um 310 auf 1866 Beschäftigte. Die Lebensmittelfirma sprach auch eine Reihe Kündigungen aus. 1934 meldete ein Informant an die in Prag sitzende Exil-SPD (2), dass Maggi 160 ArbeiterInnen entlassen habe, «in der Mehrzahl junge Leute, die früher den sozialistischen Vereinen angehört haben». Und ein Jahr später war aus der gleichen Quelle zu erfahren, dass der gewerkschaftlich einst gut organisierte Betrieb heute «völlig verludert» sei, «es werden nur waschechte Leute eingestellt, die früher schon vom gewerkschaftlichen Standpunkt aus Lumpen waren».
Ein NS-Musterbetrieb
Der Singener Bürgermeister Philipp Herbold achtete sorgsam darauf, dass die Betriebe im (nationalsozialistischen) Stadtrat vertreten waren, und zwar von Leuten, die «möglichst in der Direktion dieser Werke mitzureden» hatten. Für Maggi übernahm Rudolf Weiß diese Aufgabe. Der Prokurist war 1939 von der Berliner Maggi-Direktion nach Singen beordert worden; der Kampfgefährte Hitlers war Parteimitglied seit den zwanziger Jahren, Blutordensträger und Offizier des Sicherheitsdiensts. Als Betriebsobmann hatte Weiß über die Umsetzung des nationalsozialistischen Gedankengutes im Unternehmen zu wachen. Ein Diktator sei er gewesen, erinnert sich der heute 83jährige ehemalige Maggi-Arbeiter Josef Dusel. Der (nationalsozialistische) Geschäftsleiter Rudolf Brüggemann habe gekuscht vor ihm. Weiß habe auch das Betriebsklima nachhaltig geprägt, ständig sei man überwacht worden.
Die Maggi-Direktoren gingen immer etwas gründlicher zu Werke als die anderen. 1935 ließ sich die Lebensmittelfirma (wie die Aluminium-Walzwerke eine GmbH deutschen Rechts mit Schweizer Kapital) amtlich beglaubigen, dass «sämtliche Gesellschafter» sowie «sämtliche Geschäftsführer, Prokuristen und Bevollmächtigte arischer Abstammung» seien. Im gleichen Jahr noch vermeldete das Unternehmen die Gründung der ersten Singener Werkschar («die SA des Betriebes»), 1937 folgte eine reine Frauen-Werkschar. 1940 endlich wurden die Bemühungen des Unternehmens auch hier anerkannt: Maggi-Singen erhielt den prestige- und auftragsfördernden Titel eines «nationalsozialistischen Musterbetriebs» (das Berliner Maggi-Werk hatte sich das Prädikat bereits 1938 verdient).
Im Führungskader der Aluminium-Walzwerke Singen saßen derweil mehrere lokale Funktionäre der NSDAP. Einer war Alfons Fuchs: Mitbegründer der Singener Parteisektion, Vertreter der Alu-Geschäftsleitung im Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister von Singen und Ortsgruppenleiter der NSDAP.
Der Direktor des Werkes, Hans Constantin Paulssen, trat nie in die Partei ein; als ehemaliger Offizier des Freikorps Baltikum aber hatte er zahlreiche alte Kombattanten in seinem Unternehmen untergebracht – «die sah man später», schrieb die Singener Antifaschistin Käte Weick in ihren Erinnerungen «Widerstand und Verfolgung in Singen und Umgebung», «fast ausnahmslos in den Reihen der NSDAP und ihrer Untergliederungen wieder». Die Aluminium-Walzwerke seien so zu einer Keimzelle der sich formierenden faschistischen Bewegung geworden. Paulssen wurde während des Krieges zum Wehrwirtschaftsführer ernannt, er hatte damit «in persönlicher und charakterlicher Beziehung den Anforderungen des nationalsozialistischen Staates» entsprochen.
Das sah wohl auch die Alusuisse-Vorläuferin Aluminium-Industrie-AG (AIAG) so, der das Singener Werk gehörte. Sie gründete 1939 die Aluminium-Industrie-Gemeinschaft Konstanz und betraute Paulssen mit deren Leitung. Damit war der Singener Alu-Chef – zumindest offiziell – der Verwalter des AIAG-Imperiums auf deutschem Boden. Dazu gehörten – neben dem Singener Aluminium-Werk mit seinen Tochtergesellschaften Tantal/Warschau, Kluge & Winter/Hamburg und Aluminium-Gießerei Villingen – die Tonerdewerke Martinswerk in Bergheim/Erft, die Chemische Fabrik Goldschmieden/Breslau und die Aluminium-Hütten in Rheinfelden/Baden und Lend/Österreich.
Die Schweizer Konzernchefs zogen sich damit aber keineswegs aus ihren deutschen Unternehmungen zurück. Bis Kriegsende – das fand die Historikerin Sophie Pavillon für alle drei Betriebe heraus (3) – kamen sie mehrmals die Woche über die Grenze, «um die Filialen in Singen zu unterstützen». Auch Rohstoffe seien problemlos ausgetauscht worden.
Einen anfänglich schweren Stand hatte allem Anschein nach nur die Georg Fischer AG, eine direkte Zweigstelle des Schaffhauser Stammwerkes. Die Partei misstraute dem Schweizer Kader: wegen angeblicher Devisenvergehen wurde der langjährige Betriebsleiter Leuenberger mit fünf weiteren Direktionsmitgliedern vorübergehend inhaftiert.
Zug um Zug wurden die Schweizer Manager durch Deutsche ersetzt und sämtliche Beschäftigte auf ihre politische Gesinnung überprüft. Nach einem Jahr Unterbrechung kamen dafür endlich wieder Wehrmachtsaufträge ins Haus. 1939 schickte die Schaffhauser Generaldirektion schließlich Alfred Horstmann vor. Der in Schaffhausen lebende, mit einer Schweizerin verheiratete Deutsche war bereits seit 1934 Mitglied der NSDAP-Ortsgruppe Schaffhausen.
Arbeitssklaven aus dem Osten
Dann entfachte Deutschland den Krieg. Die Überfälle auf die Nachbarländer sorgten für volle Auftragsbücher. Maggi stellte Suppen für die deutschen Soldaten her. (1943 betrugen die Wehrmachtsbestellungen zwei Drittel der Gesamtproduktion des Singener Werks, im letzten Kriegsjahr waren es hundert Prozent.) Alu-Singen, schon lange vor dem Krieg in die Aufrüstung einbezogen, produzierte Kochgeschirr, Feldflaschen, Tiefkühlfolien für die Wehrmacht und zunehmend Konstruktionsteile für deutsche Jagdflugzeuge.
Die GF hatte ebenfalls früh von der Wiederbewaffnung Deutschlands profitiert. 1935 machten Wehrmachtsaufträge bereits dreißig Prozent der Singener Produktion aus. Zwischen 1938 und 1944 stieg die Fertigung von Granaten, Minen und Bombengehäusen von zweihundert auf zehntausend Tonnen im Jahr (etwa sechzig Prozent des Geschäftsvolumens).
Mit dem vorhandenen Personal konnten die Unternehmer das nicht schaffen, zumal die Einberufungen Lücken rissen, die mit zunehmender Kriegsdauer nicht gefüllt werden konnten. Mehr Frauen waren trotz großer propagandistischer Anstrengungen kaum für die Fabrikarbeit zu gewinnen; selbst die wachsende Zahl der Kriegsgefangenen reichte nicht aus.
Wo immer die deutschen Truppen einmarschierten, hoben die Besatzungsbehörden Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft aus. In Russland, Weißrussland und der Ukraine gingen sie besonders rücksichtslos vor, schließlich handelte es sich bei diesem Feldzug um einen «Vernichtungskrieg gegen die slawischen Untermenschen». Junge Frauen, Männer, sogar Kinder wurden aus den Familien gerissen, in Viehwagen gesperrt und nach Deutschland verfrachtet.
Oft dauerte die Fahrt aus dem Osten zehn Tage, und fast immer kamen die Menschen ausgezehrt an. Drei Tage hätten sie nichts zu essen bekommen, berichtet beispielsweise Antonina Danilowna Trinoshenko, die im November 1942 in Singen eintraf. Auf den Bahnhöfen mussten sie sich begutachten und für die Betriebe aussortieren lassen, von Menschen, «die auf uns mit einem Stock» zeigten.
In den Lagern, auch denen in Singen, war die Versorgung nicht besser: Die Menschen dort hätten «schon alles gegessen, was sie gefunden haben, sogar Gras», erzählt die 1943 nach Singen verschleppte Ukrainerin Serafina Kusmiwna Skorobatsch (1). Bis Kriegsende waren in Singen über dreitausend ausländische ZwangsarbeiterInnen (inklusive Kriegsgefangene) eingesetzt.
Nach einer Schätzung der Stadtverwaltung (1948) arbeiteten bei Maggi 164 Kriegsgefangene und 184 ZwangsarbeiterInnen, bei Alu-Singen 403 Kriegsgefangene und 792 ZwangsarbeiterInnen, bei Georg Fischer 68 Kriegsgefangene und 1536 ZwangsarbeiterInnen. Die Zwangsverpflichteten kamen unter anderem aus Polen, Frankreich, Holland und später aus Italien, die größte Gruppe aber bildeten die Verschleppten aus der Sowjetunion.
Als «slawische Untermenschen» standen die UkrainerInnen, WeißrussInnen und RussInnen nach den polnischen ArbeiterInnen auf der untersten sozialen Stufe. Ihr Leben in den Lagern der Betriebe, die sie angefordert hatten, war bis ins Detail geregelt: Sie durften mit den einheimischen ArbeiterInnen nicht reden; wer außerhalb des bewachten Geländes erwischt wurde, musste mit KZ rechnen; auf Fluchtversuch und sexuellen Kontakt mit Deutschen stand die Todesstrafe. Und doch gab es immer wieder deutsche ArbeitskollegInnen (wie Josef Dusel), die den sogenannten OstarbeiterInnen aus dem Alu-Lager Tann, dem Maggi-Lager Gütterli und den beiden GF-Lagern Ostend und Westend heimlich ein Stück Brot oder einen Apfel zuschoben.
72-Stunden-Woche
Die strikten Vorschriften für die OstarbeiterInnen hatten sich nicht die Betriebsleitungen ausgedacht, sie beruhten auf Reichserlassen und waren somit allgemeingültig; für die Festlegung ihrer Lebensmittelrationen etwa war das Reichsernährungsministerium zuständig. Den größten Teil des ebenfalls vorgeschriebenen Ostarbeiter-Lohns sackte der Staat über eine hohe Sondersteuer gleich selbst ein, der Rest ging für Unterbringung und Verpflegung drauf. Die Arbeitszeiten (sie galten auch für die deutschen ArbeiterInnen) wurden – zunächst von oben verordnet, später auf Antrag der Unternehmer – jeweils den Erfordernissen der Kriegswirtschaft angepasst.
Sie stiegen auf 56, dann auf 60 Stunden pro Woche; in einigen Rüstungsabteilungen, wie bei Alu-Singen, waren sogar 72 Arbeitsstunden verlangt. «Wir arbeiteten von morgens bis abends, auch nachts», erzählt Nikolaj Kowalenko, ein ehemaliger Zwangsarbeiter bei Georg Fischer. Das Schmelzmaterial zum Füllen der Gussformen mussten sie in Wagen transportieren, die so schwer waren, dass sie sich kaum von der Stelle bewegen ließen. Wer nicht durchhielt und ohnmächtig wurde, sei geschlagen worden. «Wenn sie nach einer Zeitlang nicht mehr aufstanden, trugen unsere Leute sie in die Baracken. Es war grausam.»
Doch die Unternehmer hatten durchaus Spielräume. Als sie sahen, dass die Produktion sich mit halb verhungerten ArbeitssklavInnen nicht aufrechterhalten ließ, wurden die Bestimmungen gelockert und die Arbeitszeiten etwas zurückgeschraubt. Wirtschaftsvertreter und sogar das Rüstungskommando waren sich zudem einig, dass es keinen Sinn hat, «den Leuten so viel von ihrem Verdienst abzuschöpfen, dass ihnen praktisch der Gegenwert von drei bis vier Zigaretten pro Tag übrig bleibt». Leistungslohn war nun erlaubt, wer mehr arbeitete, bekam ein bisschen mehr Lohn und unter Umständen auch etwas mehr zu essen.
Auch die Geschäftsführung der Alu-Singen und (zumindest nach eigenen Angaben) der Georg Fischer AG hatten sich 1942 um Nahrungsmittel-Sonderzuteilungen für die OstarbeiterInnen bemüht. In der Maggi degradierte derweil Betriebsobmann Weiß einen Aufseher, weil er sowjetischen ArbeiterInnen Essen zugeschoben hatte.
Überhaupt herrschte im Lager der Lebensmittelfirma ein strenges Regime; es kam zu schweren Misshandlungen, die von Weiß gedeckt wurden. Der Lagerleiter Fritz Gisy sei «ein Schweinehund» gewesen, sagt der ehemalige Maggi-Arbeiter Josef Dusel, er habe die Leute «büßen lassen» und bei der Gestapo angezeigt. 1943, nach einem Essensstreik von polnischen und ukrainischen ArbeiterInnen, kehrten mindestens drei der sechs vermeintlichen Rädelsführer nicht mehr aus dem KZ ins «Gütterli» zurück.
Fünfzig Tote, mindestens
Ende 1944, der Krieg war unübersehbar verloren, wurden die Verhältnisse etwas besser: Einige Unternehmer begannen in den Arbeitssklaven plötzlich Mitstreiter für ein nichtbolschewistisches, «neues Europa» (so ein Alu-Betriebsobmann) zu sehen; in der Maggi versuchte der Betriebsobmann sogar, ukrainische Arbeiter für die Waffen-SS anzuwerben.
Für manche aber kamen die Verbesserungen zu spät, sie hatten die Strapazen der Zwangsarbeit nicht ertragen. Krankheiten wirkten sich bei den entkräfteten Menschen schnell tödlich aus. Hinzu kam auch die psychische Belastung, Kriegsgerät herstellen zu müssen, das gegen die eigenen Landsleute gerichtet wurde. – Da war etwa die Frau aus dem Alu-Lager Tann, die ihrem Leben ein Ende setzte, indem sie Lösungsmittel trank. Oder der Junge, der sich mit Sacharin vergiften wollte und dabei taub und blind wurde. Oder Iwan Rückin, der, wie so viele, vor dem Elend in die Schweiz flüchten wollte: Er wurde vom Alu-Werkschutz erschossen. Fünfzig Tote können heute durch Dokumente und Zeitzeugnisse belegt werden, wahrscheinlich aber waren es mehr.
Im Juli 1942 hatte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement seine Weisung zurückgenommen, dass «alle aus Deutschland auf das Schweizer Territorium geflohenen russischen und polnischen Gefangenen erbarmungslos und systematisch an die Grenze» zurückzustellen seien. Zivile ZwangsarbeiterInnen jedoch durften noch bis Mitte 1944 nicht hereingelassen werden. Kurz vor Kriegsende wurde die Grenze schließlich wieder ganz zugemacht.
Am Morgen des 22. April 1945 sei dann plötzlich ein Gerücht durch das Lager Tann gerast, erinnert sich die ehemalige Zwangsarbeiterin Angelina Jakowlewa: Die Schweizer hätten die Grenze geöffnet. So zogen viele los. Und in der Tat – niemand hinderte sie mehr an der Flucht; ein deutscher Soldat habe an der Grenze nur die Deutschen gestoppt.
Doch ihre Flucht war im Grunde genommen eine Abschiebeaktion. Drei Tage zuvor hatten die Singener Stadtoberen und die Industriebetriebe bereits versucht, die ausländischen ArbeiterInnen in einem Auffanglager zusammenzufassen und aus der Stadt zu schaffen. Diese aber trauten dem Versprechen (Ausreise in die Schweiz) nicht und blieben, wo sie waren. Alu-Chef Paulssen soll sich schließlich persönlich beim Schweizer Bundesrat für die Öffnung der Grenze verwendet haben.
Als am 24. April 1945 die französischen Truppen einmarschierten, war die Stadt beinahe menschenleer. Die meisten ZwangsarbeiterInnen hatten sich in die Schweiz abgesetzt, ebenso ein Großteil der Singener Bevölkerung. Zu diesem Zeitpunkt waren die Geschäftsführer der drei Großbetriebe bereits mit einem Schutzbrief des schweizerischen Konsulats ausgerüstet; die Hakenkreuzfahnen hatten sie einrollen lassen, dafür prangte an den Werkstoren das besitzanzeigende Schweizerkreuz.
Für die zurückgebliebenen ZwangsarbeiterInnen begann in Singen ein neues Leben. Sie klauten Schweine, feierten und betranken sich, und gelegentlich suchten sie das ehemalige Aufsichtspersonal heim. Vier Monate genossen «die Russen» ihre Freiheit; Ende August wurden sie von französischen Soldaten in Züge gesetzt und – wie die in die Schweiz geflüchteten ArbeiterInnen – in die Sowjetunion verfrachtet. – Ob sie überhaupt dorthin zurückwollten, hatte niemanden interessiert.
***
Maggi-Betriebsleiter Rudolf Brüggemann verlor seinen Posten, Rudolf Weiß soll 1945 Selbstmord begangen haben. GF-Chef Alfred Horstmann wurde von Schweizer Managern abgelöst. Hans Constantin Paulssen übernahm nach seiner Entnazifizierung 1948 wieder die Leitung von Alu-Singen. Er erhielt 1953 das Große Bundesverdienstkreuz und wurde ein Jahr später zum Vorsitzenden der Deutschen Arbeitgeberverbände (bis 1964) gewählt.
Fußnoten
(1) Diese Informationen und die Zitate der ZwangsarbeiterInnen sind dem Buch von Wilhelm Waibel, «Schatten am Hohentwiel» (s. «Eine spät erforschte Geschichte»), und dem Film von Frédéric Gonseth «Hitlers Sklaven» entnommen.
(2) Aus allen Teilen Deutschlands trafen in Prag Nachrichten aus den Betrieben ein, sie wurden zusammengetragen zu den «Deutschland-Berichten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands», den sogenannten Sopade-Berichten.
(3) Zitat aus dem Dokumentarfilm von Frédéric Gonseth «Hitlers Sklaven», ausgestrahlt im Oktober 1997 auf arte. Von Sophie Pavillon erschien im selben Jahr in der «Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs» die Studie: «Trois filiales d'entreprises suisses en Allemagne du Sud et leur développement durant la période nazie».
Eine spät erforschte Geschichte
«Zustände, wie man sie gemeinhin mit einem Lager verbindet, zerlumpte und verdreckte Menschen, dreimal täglich Kohlsuppe, keine hygienischen Einrichtungen, konnte die Maggi schon aus eigenem Interesse nicht einreißen lassen», schrieb 1989 noch der Gewerkschafter und Historiker Willy Buschak in seiner «Geschichte der Maggi-Arbeiterschaft». Allein die Tatsache, «dass sie in einem Lebensmittelbetrieb arbeiteten», habe den Zwangsarbeitern «ein gewisses Maß an menschlicher Behandlung» garantiert. Dass bei Maggi, was die ZwangsarbeiterInnen anbetraf, von Hygiene und Menschlichkeit keine Rede sein konnte (und bei Alu-Singen gar geschossen wurde), haben die Recherchen von Wilhelm Waibel zutage gebracht.
Über drei Jahrzehnte hinweg hatte Waibel alles zum Thema gesammelt: Aussagen der Bevölkerung, Dokumente aus öffentlichen Archiven, vor allem aber Adressen ehemaliger ZwangsarbeiterInnen. Während die Georg Fischer AG ihm wertvollen Einblick in die alte Personalkartei gewährte, mauerte die Maggi-Führung (es hieß zunächst, sie habe nichts mehr von Bedeutung, so Waibel); und den Zuständigen im Aluminium-Walzwerk [heute: Constellium] musste der Geschichtsforscher erst selbst den Weg zu den angeblich nicht vorhandenen Akten in ihrem Archiv weisen. Was sich schließlich in den Werksarchiven fand, war lückenhaft und ergab ein allzu schönes Bild.
Dank der Kooperationsbereitschaft der Georg Fischer AG gelang es Wilhelm Waibel 1989, die ersten Kontakte mit ehemaligen ZwangsarbeiterInnen aus der Ukraine aufzunehmen. Deren Aussagen, veröffentlicht in dem Buch «Schatten am Hohentwiel», demontierten das öffentlich gepflegte Bild gründlich. Sie schufen auch eine Grundlage für Frédéric Gonseths 1997 ausgestrahlten Dokumentarfilm «Hitlers Sklaven».
Die Stadtverwaltung von Singen – auch sie hatte während des Krieges ZwangsarbeiterInnen beschäftigt – unterzeichnete 1993 einen Städtepartnerschaftsvertrag mit der ukrainischen Stadt Kobeljaki (aus diesem Gebiet kamen die meisten in Singen eingesetzten sowjetischen Zwangsverpflichteten). Im Rahmen dieser Partnerschaft haben inzwischen alle drei Unternehmen mehrfach Hilfkonvois mit Geld- und Sachspenden unterstützt, auch wurden ZwangarbeiterInnen-Delegationen empfangen.
Weitere Quellen
Buschak, Willy: «Die Geschichte der Maggi-Arbeiterschaft». Ergebnisse Vlg., Hamburg 1989.
«Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1934–1940». Verlag Zweitausendeins, Frankfurt a.M. 1980.
Köhler, Ernst: «Die Stadt und ihre Würze». Wagenbach, Berlin 1983.
Meier, Ingeborg: «Die Stadt Singen am Hohentwiel im Zweiten Weltkrieg». Konstanzer Dissertationen Bd. 337. Hartung-Gorre, Konstanz 1992.
Peter, Roland: «Rüstungspolitik in Baden». Oldenbourg Verlag, München 1995.
Weick, Käte: «Widerstand und Verfolgung in Singen und Umgebung». Plambeck Vlg., Neuss 1982.
Zang, Gert: «Die zwei Gesichter des nationalsozialismus. Singen am Hohentwiel im Dritten Reich». Thorbecke Vlg., Sigmaringen 1995.
© Brigitte Matern, erschienen in WOZ Nr. 51 vom 18.12.97