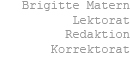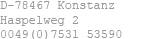Die Goldbarren der Menschheit
Er fühlt sich in zwei Kulturen zu Hause, er war Parteipolitiker und kritisierter Schriftsteller zugleich und pendelte in seinen Romanen auch mal zwischen Himmel und Erde – Tschingis Aitmatow ist ein Wanderer zwischen den Räumen.
Interview: Brigitte Matern und Pit Wuhrer
Frage: In Ihrem letzten Roman, «Das Kassandramal» von 1994, waren die USA und der Weltraum Schauplatz. Mit Ihren Erinnerungen, «Kindheit in Kirgisien», sind wir wieder in Kirgisistan gelandet. Wenden Sie sich literarisch wieder Ihrer Heimat zu?
Tschingis Aitmatow: Ich hatte mich in der Tat entfernt. Das geschah im Rahmen der Entwicklung meiner schöpferischen Suche. «Das Kassandramal» spielt im Weltraum, um von dort einen Blick auf unser irdisches Leben werfen zu können.
Es mangelte nicht an Kritik an diesem Buch.
Es ist letztlich ein polemisches Buch. Die Leser ziehen unterhaltsamere Themen vor, auch aufbauendere, ihrem Leben nähere Stoffe. Aber auf der Suche nach großen literarischen Fragestellungen ist es nötig, über die alltäglichen, uns gewohnten Vorstellungen hinaus in andere Räume vorzustoßen. Das Buch ist polemisch und hat Polemik hervorgerufen. Allerdings ist diese Polemik von Leuten vorgetragen worden, die das Buch prinzipiell ablehnen oder einfach nicht begriffen haben (im «Kassandramal» teilen Ungeborene durch ein Mal auf der Stirn der schwangeren Frauen mit, dass sie lieber nicht auf diese Welt kommen wollen, ein Kosmonaut im All, der sich selbst «Mönch Filofej» nennt, hat ein Verfahren erfunden, das dieses Zeichen sichtbar werden lässt, d.Red).
Aber Sie bleiben nicht dem Weltraum verhaftet?
Ich verstehe sehr gut, wenn Sie fragen, ob ich Anstalten mache, zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Weltliteratur besteht immer aus nationalen Ursprüngen und Nationalliteratur, deshalb bleibt die Nationalliteratur immer das Fundament. Das Buch, an dem ich jetzt arbeite, hat wieder mit meiner engeren Heimat zu tun.
Ihr Publikum wird die vertraute zentralasiatische Landschaft wiederfinden?
Natürlich, die Landschaft und die Figuren.
In «Kassandramal» ist vom Überleben der Menschheit die Rede. Früher spielten Deserteure der Roten Armee, Frauen, die mit Traditionen brechen, Korruption, Drogenhandel und Naturzerstörung in der Sowjetunion eine Rolle. Die Kritik gesellschaftlicher gesellschaftlicher Zustände ist offensichtlich Ihr zentrales Anliegen.
Realistische Literatur bemüht sich immer darum, das Leben in seiner Substanz zu erkennen und darzustellen. Der Autor versucht sich in diesem Zusammenhang natürlich immer mit den Themen zu beschäftigen, die ihn interessieren und umtreiben. Und die Leser suchen in der Literatur Bestätigungen für ihre Gedanken und ihre Sicht des Lebens.
Dieses Leben spielte zum größten Teil in der Sowjetunion. Zu Zeiten der Perestroika sagten Sie, dass die Leistungen des Sozialismus offenkundig seien. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
Das hängt davon ab, was man darunter versteht. Die sozialistischen Ideen haben ihren Wert behalten. Selbst in einem Land wie der Schweiz gibt es Verwirklichungen von Ideen, die eigentlich sozialistischen Ursprungs sind.
Tatsächlich? Welche meinen Sie?
Zum Beispiel die Lösung einer ganzen Reihe grundlegender sozialer Aufgabenstellungen; alle Einrichtungen des Zusammenlebens im Sinne einer Befriedigung der Bedürfnisse von vielen. Die Menschenrechte haben hier doch einen großen Stellenwert, dazu gehören die Volksabstimmungen, das allgemeine Bildungssystem, Volksbildung, medizinische Betreuung … es gibt viele konkrete Beispiele.
Sie waren aber einmal stolz auf die Sowjetunion. «Unsere Gesellschaft», sagten Sie vor elf Jahren, «ist menschlicher.»
So aus dem Zusammenhang gerissen, kann ich diese Aussage jetzt schwerlich bestätigen oder dementieren. Aber nehmen wir zum Beispiel Literatur und Kunst: In keinem anderen Land wurde diesem gesellschaftlichen Sektor so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie in der Sowjetunion. Das sagt noch nicht unbedingt etwas aus über die Qualität der Literatur, aber etwas über die Gesellschaft, die der Literatur und Kunst einen so hohen Stellenwert einräumte.
Was hat in diesem Zusammenhang der Zusammenbruch der UdSSR für Sie bedeutet?
Es war eines der tiefgreifendsten und kompliziertesten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wenn nicht gar der Menschheitsgeschichte. Es gibt kaum etwas Vergleichbares. Das wohl Bemerkenswerteste an dieser gewaltigen Veränderung war, dass sie ohneBlutvergießen vor sich ging. Den Rest kann man dann sehr unterschiedlich bewerten, ebenso die Gründe, warum es geschehen ist und wie es sich weiterentwickeln könnte; der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen.
Der Zerfall hat freilich auch starke nationalistische Kräfte freigesetzt. So wurde auch in Ihrer Heimat Kirgisistan alles Russische plötzlich abgelehnt.
In Kirgisistan gab es dieses Ausmaß an Nationalismus nicht. Bei uns haben sich die Entwicklungen am demokratischsten abgespielt, und wir haben im Vergleich mit den anderen Ländern auch die demokratischsten Verhältnisse. Aber generell gab und gibt es natürlich Chauvinismus und Nationalismus – beides sind Ausdruckformen dieser gewaltigen Veränderungen. Das kennzeichnet die ganze Nach-Perestroika-Welt in der gesamten Region, in der zuvor die Ideen des Sozialismus vorherrschten – siehe Jugoslawien. Zur Überwindung der Widersprüche, die dabei hervorkamen, gibt es kein einfaches Rezept.
In Kirgisistan wurde ein Sprachengesetz verabschiedet, das das Kirgisische zur alleinigen Landessprache machte. Sie selbst haben sich zu Sowjetzeiten für den Erhalt und die Förderung der kirgisischen Kultur stark gemacht, dabei aber immer wieder betont, wie wichtig die russische Sprache und die Achtung anderer Kulturen ist.
Diese Entwicklung war eigentlich etwas ganz Normales, damit musste man rechnen. Sehr viele wollten es gerade so haben. Man könnte sagen, dass ein Ausgleich hergestellt wurde. Der einseitigen Russifizierung wurde die Wiederherstellung eigener nationaler Werte und der eigenen Sprache entgegengesetzt. Die Zweisprachigkeit ist im Übrigen geblieben.
Von Perestroika hatten Sie sich viel erhofft, auf dem Feld der Literatur sogar «regelrechte Vulkanausbrüche». Was ist von dieser Erwartung geblieben?
Die Perestroika war ein geistiger Höhenflug. Aber mit der Beendigung der Perestroika und mit dem vollständigen Übergang zur Marktwirtschaft vollzogen sich grundlegende Veränderungen. Literatur und Kunst gehörten mit zu den aktuellsten Ausdrucksformen im gesellschaftlichen Leben – und plötzlich wurde das Bedürfnis nach Literatur und Kunst ersetzt durch die Ware Literatur und Kunst. Dabei wurde absolut nichts gewonnen. An die Stelle der politischen Zensur ist die Zensur des Marktes getreten – und die ist noch brutaler. Die politische Zensur konnte man überlisten, man konnte auch Kompromisse schließen. Bei der Zensur des Marktes gibt es keine Kompromisse. Alles, was Gewinn verspricht, das geht, was solchen Erwartungen aber nicht entspricht, wird abgedrängt.
Gibt es in Kirgisistan keine lebendige Literaturszene mehr?
Natürlich gibt es das noch. Aber alles, was sich dort abspielt, befindet sich unter dem Druck des Marktes. Am meisten leidet darunter die Lyrik. Früher hatte sie einen sehr hohen Stellenwert, jetzt ist sie nur noch ein privates Hobby, eine Liebhabersache. Die Auflagen sind mehr als bescheiden.
Und Papier gibt es noch?
Papier schon, aber kein Geld dafür.
Ihre Hoffnungen sind also durch die Beendigung der Perestroika enttäuscht worden?
Das muss man genauer sagen: Uns hat niemand persönlich beleidigt oder verletzt, es ist nur einfach eine schwierigere, kompliziertere Zeit angebrochen. Die Wirklichkeit wurde in mancher Hinsicht brutaler. Und jetzt steht die Aufgabe an, in dieser brutalen Wirklichlichkeit zu überleben. Es ist ein harter Kampf. Auf der einen Seite ist der Markt, auf der anderen sind die Ideen.
Es gibt aber auch das Gegensatzpaar Macht und Freiheit. Sie waren nicht nur Schriftsteller, sondern sind auch in der Politik aktiv; Sie stehen also auf beiden Seiten …
Richtig.
… und sind jetzt Botschafter eines Landes, das kürzlich von Amnesty International wegen mangelnder Meinungsfreiheit kritisiert wurde. Stehen Sie hier vor einem Dilemma? Wie gehen Sie damit um?
Ich würde nicht sagen, dass ich da in einem sehr großen Dilemma stecke. Im Verhältnis zu den anderen Ländern ist Kirgisistan außerordentlich freiheitlich. Gleichzeitig sollte man nie außer Acht lassen, dass die Demokratie nicht die Göttin aller Freiheiten ist. Auch sie hat ihre Mängel. All die Freiheiten, die man sich wünscht, lassen sich auch in einer Demokratie und durch eine Demokratie so schnell nicht umsetzen. Man muss zum Beispiel auch die Schichten sehen, die von der Einführung der Demokratie profitiert haben und die das Wort Demokratie ständig im Mund führen – es sind oft genau dieselben, welche die Möglichkeiten der Demokratie für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Freiheit und Verantwortung sind ein Paar und verlangen nach einem Ausgleich, das braucht viel Zeit. Wir hatten diesbezüglich eine Illusion, wir dachten, die Demokratie kommt und alles realisiert sich wie von selbst. Demokratie aber muss erlernt, angewandt und umgesetzt werden können. Da muss man auch einiges dafür tun. Einer unserer Dichter, der Russe Jewgeni Jewtuschenko, drückte es so aus: «Die Freiheit will auch fressen.»
Die Umsetzung von politischen Vorstellungen hat Sie immer interessiert – zur Zeit des Umbruchs waren Sie politisch aktiv: Mitglied im Obersten Sowjet, Berater Gorbatschows usw. Was trieb Sie zu solchem Engagement?
Die Perestroika war für mich die Apotheose dessen, wofür ich kämpfte; sie war ein Höhepunkt in meinem Leben. Überall löste die Perestroika höchste Erwartungen aus, Erwartungen neuer historischer Phänomene. Solche Erwartungen inspirieren und spornen an. Außerdem sehe ich gar nichts Schlimmes darin, wenn jemand politisch aktiv wird. Wenn jemand von dem überzeugt ist, wofür er sich einsetzt, dann soll er das auch tun.
Sie haben sich innerhalb des Systems eingesetzt …
Die Dissidenten haben ihre Rolle durchaus erfüllt, aber wir konnten nicht alle Dissidenten werden. Es ist sehr viel schwieriger von innen her, innerhalb des politischen Organismus etwas zu erreichen und umzusetzen.
… und hofften auf einen demokratischen, humanen Sozialismus?
So war es.
Hat diese Doppelfunktion – Politiker hier, Schriftsteller dort – Ihre Arbeit geprägt?
Das war keine Doppelfunktion – so ist das Leben unter den realen Bedingungen. Die Aufgabe ist doch, Ideen umzusetzen oder es wenigstens zu versuchen.
Sie haben sich nicht nur in Ihren Büchern, sondern auch in Artikeln und Reden für Umweltschutz eingesetzt. Der Issyk-Kul, Kirgisistans großer See, war Ihnen immer wichtig. Hat dieser Einsatz während der Sowjetzeit etwas bewirkt?
Das ist schwer abzuschätzen. Ich denke aber, dass mein Einfluss darin lag, Ökologie überhaupt zu einem Thema zu machen. Sich als einzelner Mensch mit einem ganz konkreten, einzelnen Thema zu befassen, bringt nicht sehr viel – man braucht eine allgemeine Tendenz. Vor einiger Zeit hatten sich die Menschen nicht darum gekümmert, ob das Wasser sauber ist, es war ihnen egal, was mit dem Boden passiert, niemand hatte sie darauf aufmerksam gemacht. Aber jetzt ist dieNotwendigkeit eines Umweltschutzes zu ihnen durchgedrungen.
Haben Sie noch eine gesellschaftliche Vision, nachdem das sozialistische System so grandios gescheitert ist?
Am Ende des 20. Jahrhunderts sollten wir alle Rechnung ablegen: Wo sind wir angelangt? Was haben wir eigentlich gewollt? Und was steht uns bevor? Diese Fragen sollten nicht nur die unmittelbare Umgebung berühren, sondern alle Länder, alle Kontinente umfassen. Denn wenn weiterhin nur ein Teil der Welt aufblüht, während der andere in immer größere Armut abrutscht, kann das zu nichts Gutem führen. Wenn wir nur an unsere egoistischen Interessen denken, wird es überall zu ganz großen Konflikten kommen – und zwar überall, von der ganzen Welt bis hinein ins Wohnquartier.
Aber setzen solche Betrachtungen nicht eine Muße voraus, die kaum noch jemand hat, weil der Überlebenskampf ständig alle Kräfte fordert?
Es gibt schon noch Menschen, die sich damit befassen, das muss es ja auch geben. Wir müssen uns der Gefahren bewusst sein, die bevorstehen. In Russland gibt es eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die einen großen Teil des ganzen Reichtums angesammelt haben. Sie halten diese Reichtümer als Kapital im Westen, während Millionen ihrer Landsleute weit davon entfernt sind, auch nur ein bisschen davon zu besitzen. Das ist die so genannte Oligarchie. Wenn die sich keine ernsthaften Gedanken über die Folgen ihres Tuns macht, kann es zur Explosion, zu unglaublichen Aufständen kommen. Dann zählen all diese akkumulierten Reichtümer nichts, und dann wird auf ganz primitive Weise wieder angeglichen. Denn jeder Mensch braucht die Möglichkeit, ein erträgliches, ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Sie haben während Ihrer Lesereise gesagt, dass auch in Kirgisistan die LeserInnen schwinden …
Das stimmt, es werden immer weniger.
Lassen die rasanten Umbrüche, die auch in Kirgisistan Menschen entwurzelt haben, überhaupt noch traditionelle Erzählformen zu?
Sie berühren eine schmerzhafte Frage. Unter der Marktwirtschaft ist ein ganz anderer Typus von Literatur in den Vordergrund getreten, der der Befriedigung der Urtriebe dient. Die so genannte Massenliteratur und Massenkultur basiert auf der Ausbeutung der primitivsten Grundinstinkte: des Besitzstrebens, das vom Hunger ausgeht, des Geschlechtstriebs, der der Vermehrung dient, der Aggression, die die Kehrseite der Angst ist. Nehmen Sie alles, was auf dem Markt ist – jeder Roman, jeder Film bedient diese Bedürfnisse.
Auch Musik, Malerei, Theater sind Geiseln solcher Grundinstinkte. Die allgemein menschliche Kultur hingegen war immer darum bemüht, über diese Instinkte hinauszukommen, sie nicht zu unterdrücken, sondern sie durch Ethik, durch Ausbildung, durch Erziehung, durch Religion zu verfeinern und ein Bild vom Menschen zu schaffen, das ihn nicht nur an diese drei Grundinstinkte fesselt.
Ihr neues Buch, «Kindheit in Kirgisien», enthält mehrere traditionelle Beschwörungen, etwa das Bitten des Sämanns bei der Aussaat. Richten sich diese Gebete auch gegen diese Entwicklung der Massenkultur?
Ich glaube nicht, dass man die Massenkultur stoppen kann, sie wird weiterstürmen. Aber es braucht daneben wirkliche Kunst und Literatur, sie müssen zumindest eine Nische erhalten, damit sie sozusagen als Goldreserve bleiben. Die Kultur – das sind die Goldbarren, die in der Zentralbank der Menschheit liegen; die Massenkultur erzeugt nur schlechtes Papiergeld.
Zur Person: Ein sowjetischer Kirgise
An Ämtern und Würden hat es Tschingis Aitmatow nie gemangelt: Der gelernte Landwirt war Leninpreisträger (1968), Staatspreisträger der UdSSR (1968, 1977, 1983) und «Held der sozialistischen Arbeit» (1978). Er arbeitete als Chefredaktor zweier Kulturzeitschriften und als Mittelasien-Korrespondent der «Prawda», er war Mitglied der KPdSU und des Zentralkomitees der kirgisischen KP, Abgeordneter des Obersten Sowjets und des Volksdeputiertenkongresses und unter Gorbatschow im Präsidialrat zuständig für Kulturfragen und Nationalsprachen. 1990 wurde der Vorsitzende der Kirgisischen Filmunion und des kirgisischen Schriftstellerverbandes Botschafter der UdSSR, dann der GUS in Luxemburg; seit 1995 ist er Kirgisistans Botschafter bei der EU in Brüssel.
Der 1928 in Kirgisistan geborene Aitmatow ist zweisprachig aufgewachsen (daran erinnert er in seinem neu erschienenen Buch «Kindheit in Kirgisien»). Seine Texte schrieb er auf Kirgisisch oder auf Russisch; diese Fähigkeit nutzte er gelegentlich, um der strengeren Zensur in seinem Heimatland Kirgisistan zu entkommen (in Moskau – wie er heute sagt, seiner «fernen Heimat» – war man etwas liberaler).
Dennoch setzte er sich für die Förderung der kirgisischen Sprache ein: Ein Volk, das seine Sprache nicht kennt, verliert die Erfahrungen früherer Generationen.
Gleichzeitig betonte er stets die Bedeutung der russischen Sprache – sie sei für die kleineren Völker der Sowjetunion die Brücke zur Welt. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 stellte er sich denn auch gegen den aufkeimenden Nationalismus in Kirgisistan. Hunderttausend RussInnen verließen damals das Land; an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und Universitäten war plötzlich Kirgisisch verlangt. Erst 1996 wurde die russische Sprache wieder offizielle Amtssprache.
© Brigitte Matern und Pit Wuhrer, erschienen in WOZ Nr. 41/98 vom 8.10.1998